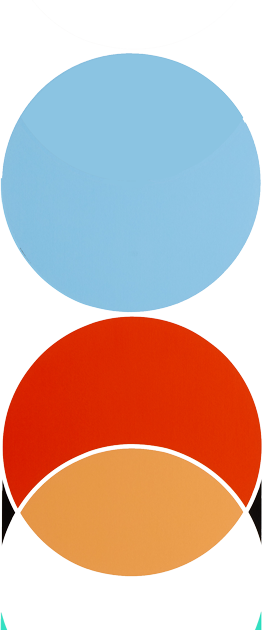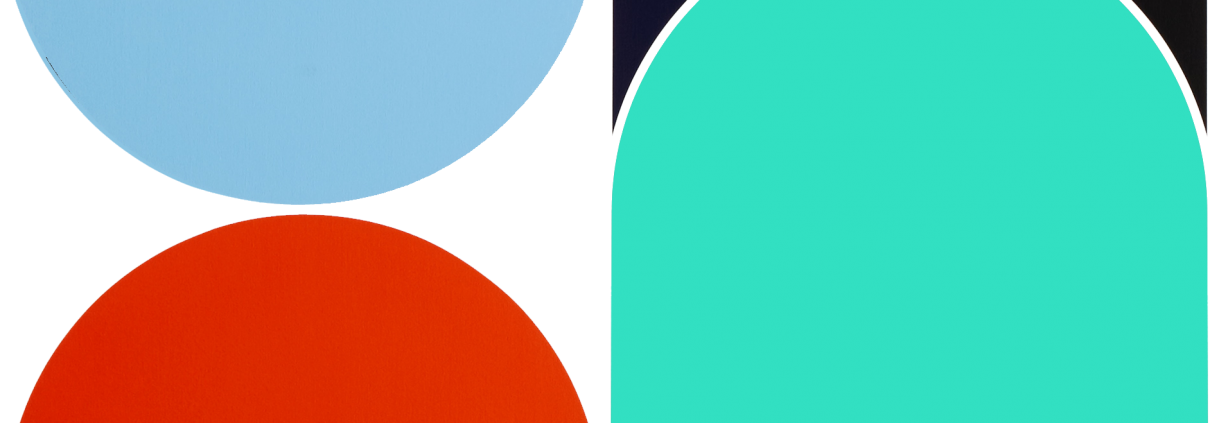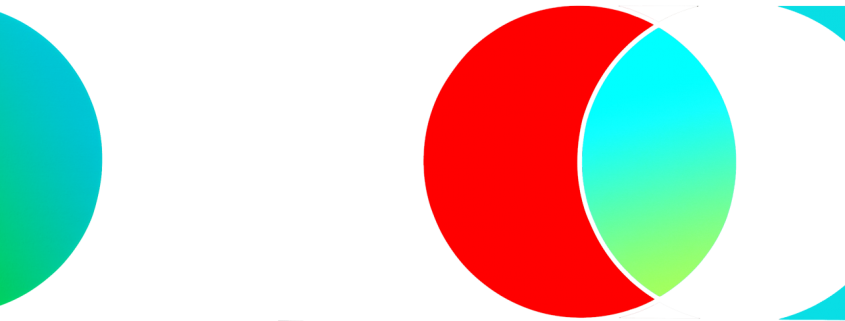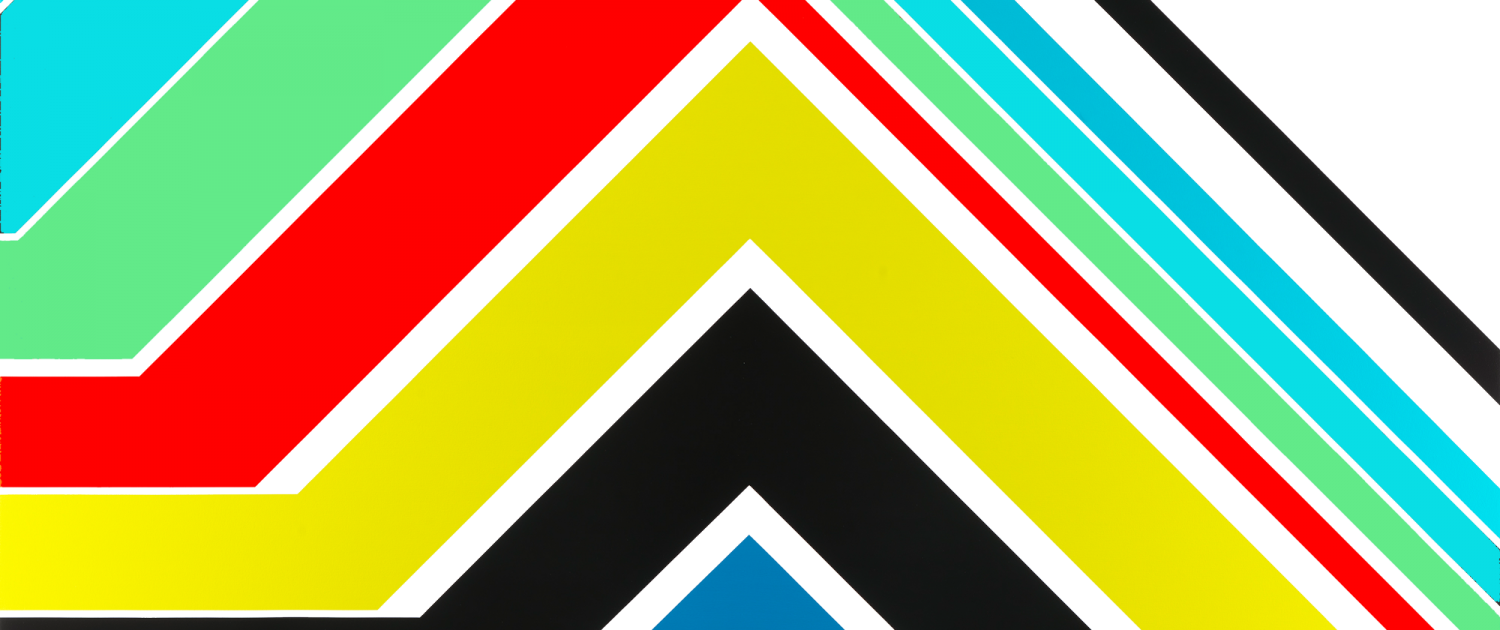Zeit für ein neues Wirtschafts- und Arbeitssystem – wie wir künftig wirtschaften und arbeiten werden
von Günter Thoma
Einleitung
I Warum wir ein neues Wirtschaftssystem brauchen
II Warum wir ein neues Arbeitssystem brauchen
III Bedingungen für ein neues Wirtschafts- und Arbeitssystem
IV Konturen eines neuen Wirtschafts- und Arbeitssystems –
Plädoyer für das Konzept „Neue Arbeit-Neue Kultur“ von Frithjof Bergmann
Einleitung
Wie der Sozialismus in seiner Endphase, so weist unser Wirtschafts- und Arbeitssystem mehr und mehr Probleme auf, die auf eine schwerwiegende Krise hinweisen. Freilich werden diese nicht als solche interpretiert, da nicht sein kann, was nicht sein darf. Vielmehr werden diese Krisensymptome als vorübergehende Begleiterscheinungen verharmlost, die ab und zu in Kauf genommen werden müssen. Doch bei genauerem Hinsehen ist diese Interpretation haltlos. Die meisten Symptome sind chronisch und verschlimmern sich; und verbessert sich einmal ein Missstand, dann nur auf Kosten eines neuen: die so genannte Finanzkrise mag vielleicht gebannt sein; aber dies nur um den Preis der darauf folgenden Staatsschuldenkrise. Bestenfalls Zyniker sehen darin eine gelungene Überwindung der von den Finanzmärkten verursachten Verwerfung von 2008. Die herrschende Darstellung, wonach all die Krisensymptome nicht mehr als Begleiterscheinungen eines ansonsten gesunden ökonomischen Systems seien, will beschwichtigen, beruhigen und uns in trügerische Hoffnung einlullen, wonach in Zukunft alles besser werde. Mit Keynes sollten wir darauf trocken antworten: in the long run we are all dead.
Warum äußert sich nicht mehr Unmut und Unzufriedenheit angesichts all der Missstände, Disfunktionalitäten und Verwerfungen, der Zwänge, Unsicherheiten und Belastungen, der zunehmenden Ungleichgewichte und Ungerechtigkeiten, namentlich der wachsenden Kluft zwischen arm und reich sowie dem Missverhältnis zwischen ökonomischer Macht und staatlicher Ohnmacht? Warum verhallen Aufrufe zum Widerstand? Warum gehen wir nicht wie einst die Menschen im Ostblock auf die Straße? Warum lassen wir uns nicht vom „arabischen Frühling“ anstecken? Weil uns ein Ziel fehlt. Nur „dagegen sein“ reicht nicht aus. Widerstand alleine ist nicht genug und verliert als solcher schnell an Kraft. Eine Alternative ist notwendig: es ist Zeit für ein neues Wirtschafts- und Arbeitssystem, für das wir uns einsetzen können. Diesem Ziel ist diese Abhandlung gewidmet: Kapitel I und II fassen die Kritik am herrschenden Wirtschafts- und Arbeitssystem zusammen und erläutern, warum wir ein neues brauchen. Kapitel III formuliert die Bedingungen für ein neues Wirtschafts- und Arbeitssystem. Kapitel IV schließlich skizziert die „Neue Arbeit“ von Frithjof Bergmann, da diese alle Bedingungen für ein neues Wirtschafts- und Arbeitssystem erfüllt. Außerdem hat sie den Charakter einer Utopie, die als solche über genügend Anziehungskraft.
I Warum wir ein neues Wirtschaftssystem brauchen
Die Abhängigkeit vom herrschenden Wirtschaftssystem
Gleich einem Wirbelsturm fegt die entfesselte Ökonomie über den Globus und zieht eine Spur an Zerstörungen und Verwerfungen hinter sich her: Umweltverschmutzung, Klimakatastrophe, Ressourcenknappheit, weltweite Beschäftigungslosigkeit und massenhaft prekäre Beschäftigungsverhältnisse, Landflucht und wachsende Slums sind die Folgen.
Das ungehemmte und unkontrollierte Wuchern der Ökonomie beschert uns darüber hinaus neue Verwerfungen: erst die Finanzkrise, neuerdings die Staatsschuldenkrise und in naher Zukunft wohl beide zusammen.
Stößt das ökonomische Treiben an Grenzen, werden diese ignoriert und übergangen, gedehnt und überdehnt bis Ungleichgewichte entstehen und kritische Schieflagen daraus hervorgehen. Märkte tendieren der Theorie nach zu Gleichgewichten, die real existierende Ökonomie lehrt uns das Gegenteil: so führt die Massenproduktion zur Marktsättigung, die jederzeit in Überproduktion umschlagen kann, wie in der Wirtschaftskrise 2009 geschehen; private Haushalte verschulden sich, weil sie mit “easy credits” versorgt werden, damit sie mehr konsumieren als sie sich leisten können. Die Finanzmärkte scheinen überhaupt keine Grenzen mehr zu kennen. Selbst die Realwirtschaft sowie Staaten werden von ihr zu Spekulationsobjekten degradiert, um die Profite auf die Spitze zu treiben. Mittlerweile zirkuliert soviel Geld an den Börsen dieser Welt, dass eine Blase nach der anderen entsteht, deren Platzen wenige Gewinner und viele Verlierer nach sich zieht und die Weltwirtschaft als Ganzes und den gesellschaftlichen Zusammenhalt bedrohen kann. George Soros, sicherlich kein Marxist, zog bereits 1997 das Fazit: “Ich habe auf den Finanzmärkten der Welt ein Vermögen erworben, und dennoch fürchte ich inzwischen, daß die uneingeschränkte Intensivierung des Laissez-faire-Kapitalismus und die Verbreitung der Werte des Marktes über alle Bereiche des Lebens die Zukunft unserer offenen und demokratischen Gesellschaft gefährden. Der wichtigste Feind der offenen Gesellschaft ist nicht länger die kommunistische, sondern die kapitalistische Bedrohung.” (George Soros, Die kapitalistische Bedrohung, DIE ZEIT, Nr. 4, 17.1.1997, Seite 25).
Seit dieser Zeit haben die Verwerfungen und Ungleichgewichte spürbar zugenommen. Die Ökonomie verspricht zwar die Probleme zu lösen, kann aber als deren Verursacher ihr Versprechen nicht halten; im besten Fall ersetzt sie ein Krisensymptom durch ein anderes – die Krise aber bleibt. Beispielsweise mag es gelingen, hier und da Beschäftigungslosigkeit abzubauen, aber dies nur um den Preis prekärer Beschäftigungsverhältnisse. Die Ökonomie kann nicht einmal mehr ihr fundamentales Versprechen einlösen, wonach Wachstum den allgemeinen Wohlstand hebt. Vielmehr ist eine Einkommensumverteilung im vollen Gange, die darin gipfelt, dass die Reichen immer reicher, die Mittelschicht dünner und die Armen immer ärmer werden.
Kein Wunder, dass sich die Stimmen mehren, die der der Ökonomie kritisch gegenüber stehen und die vor allem das Wachstum der Ökonomie begrenzen wollen: “Mehr als zwei Drittel der Deutschen zweifeln inzwischen daran, dass ihre Lebensqualität automatisch steigt, wenn die Wirtschaft wächst. Ganze Gruppen der Gesellschaft erleben schon länger, wie es ist, vom Wohlstand abgeschnitten zu sein. Anderen hat die Finanzkrise gezeigt, wie gefährlich es sein kann, wenn Banker, Unternehmer, aber auch Politiker zuallererst auf Wachstum setzen. Und sind nicht die vielen Naturkatastrophen die eindringlichste Warnung davor, wohin die wachstumsgetriebene Ausbeutung der Erde am Ende alle führen könnte – direkt in die Klimakatastrophe?
Das Bauchgefühl der Bürger. Lange Zeit wurde es nur von Außenseitern artikuliert. Wachstumskritik war in der etablierten Wissenschaft quasi ein Tabu, weiß Thomas Korbun vom Institut für ökologische Wirtschaftsforschung. Doch neuerdings schwappt die Debatte um das herkömmliche Wachstumsmodell auch in die etablierten Kreise, in Verbände, Parteien und sogar in die traditionell sehr konservative Ökonomie. Auch dort wird den Vorausdenkern immer klarer: Perspektivisch muss man sich von der traditionellen Wachstumsgläubigkeit lösen, weil sie die Welt in die Sackgasse führt.” (DIE ZEIT, Petra Pinzler und Fritz Vorholz: Wirtschaftswachstum: Sind das Spinner?, Nr. 39, 23.09.2010, Internet-Adresse: www.zeit.de./2010/39/Wirtschaftswachstum, Seite 5).
Wirtschaftswachstum ist aber nun der Dreh- und Angelpunkt unseres Wirtschaftssystems. Was würde passieren, wenn wir das Wachstum auf null herunterfahren? Welche Auswirkungen hätte das auf Gesellschaft, Staat und Wirtschaft?
Ohne Wachstum gäbe es mehr Massenbeschäftigungslosigkeit und prekäre Beschäftigungsverhältnisse als wir ohnehin schon haben. Denn die Rationalisierung der Jobarbeit, die menschliche Arbeitskraft durch technische ersetzt, lässt Jobs weg- schmelzen wie Schnee in der Frühlingssonne. Außer Wachstum haben wir in unserem Wirtschaftssystem dieser Rationalisierung nichts entgegenzusetzen. Wachstum sichert zumindest bis zu einem bestimmten Grad Beschäftigung und lässt neue Arbeitsplätze entstehen.
Bei Nullwachstum stagniert das allgemeine Wohlstandsniveau. In einer Wachstumsgesellschaft wie der unseren wären Verteilungskämpfe die Folge: wenn es keinen Zuwachs gibt, der verteilt werden kann, kommt es unweigerlich dazu, den eigenen Anteil am Kuchen zu vergrößern. Mit der Konsequenz, dass die Wohlstandsunterschiede in der Bevölkerung noch größer werden als sie bereits sind. Davon abgesehen wird es bei Nullwachstum nicht bei Stagnation bleiben, sondern der Lebensstandard wird aller Voraussicht nach sinken. Ein Grund hierfür liegt in steigenden Kosten, ein anderer darin, dass die Menschen bei Nullwachstum voraussichtlich mehr sparen, zumal sie mehr von Beschäftigungslosigkeit betroffen oder bedroht sind. Dies kann jederzeit eine wirtschaftliche Rezession nach sich ziehen, die zu einem weiteren Rückgang des Wohlstands führt.
Fallen die Wachstumsraten und stellt sich Nullwachstum ein, müssen die Gewinnerwartungen der Unternehmen nach unten korrigiert werden. Einerseits ziehen sich Investoren zurück und Kapital wandert ab. Andererseits werden stagnierende Unternehmen eine leichte Beute für Konkurrenten, so dass unerwünschte Marktkonzentrationen zunehmen. Dann: steigende Kosten lassen die Gewinne von Unternehmen zusammenschmelzen bis erste Verluste auftreten, die Konkurse nach sich ziehen.
Des Weiteren ginge die Risikobereitschaft bei Nullwachstum für unternehmerisches Handeln zurück, weniger Investitionen würden getätigt und kaum mehr Arbeitsplätze geschaffen. Würde ein Land wie Deutschland sich isoliert dem Nullwachstum verschreiben, würde es bald im internationalen Wettbewerb weniger konkurrenzfähig sein.
Wachstum ist das Mittel schlechthin, um Profite zu erzielen bzw. zu maximieren. Indem Nullwachstum dies vereitelt, untergräbt es zugleich das grundlegende, treibende Motiv des Wirtschaftens. Nicht nur eine Rezession, sondern eine beispiellose Abwärtsspirale würde einsetzen, die gar nicht aufzuhalten wäre. Der Staat sähe sich mit all den daraus resultierenden Problemen konfrontiert. Er müsste seine Ausgaben erhöhen, um die Wirtschaft zu stützen und die Konjunktur anzukurbeln. Da gleichzeitig die öffentlichen Einnahmen geringer ausfallen, müsste der Staat das wachsende Defizit durch Kreditaufnahme decken, was seine Schulden vergrößert und ihn in eine prekäre Lage gegenüber den Finanzmärkten bringt.
Die Begrenzung des Wirtschaftswachstums beschwört also sofort einen Rattenschwanz an sozio-ökonomischen Problemen herauf, die die Gesellschaft in ihrem Zusammenhalt bedrohen: “Die Wirtschaft ist ein “System mit Wachstumsdrang und Wachstumszwang. Stabilisierung auf einem einmal erreichten Niveau, Nullwachstum also, ist unmöglich. Wenn die moderne Wirtschaft nicht wächst, gerät sie in die Krise mit all den schlimmen Folgen wie Pleiten, Bankzusammenbrüchen und höherer Arbeitslosigkeit.” (“Ohne Wachstum bricht das System zusammen”, Interview von Robert Heusinger mit Christoph Binswanger auf ZEIT-online, vom 18.09.2010, Seite 1).
Wer glaubt, das herrschende Wirtschaftssystem einfach begrenzen zu können, ohne sich einschneidende Nachteile einzuhandeln, der hat sich geschnitten; wer glaubt, der Kapitalismus sei eine eierlegende Wollmilchsau, ist blauäugig: einem Nullwachstum folgt eine existenzielle Wirtschaftskrise auf den Fuß. Wer Nullwachstum fordert, den mag das gleiche Schicksal ereilen wie Gorbatschow bei seinen Bemühungen, den Sozialismus zu retten: was für diesen „Glasnost“ und „Perestroika“ waren, ist „Begrenzung“ für den Kapitalismus. Unsere Situation gleicht der Wahl zwischen Pest und Cholera: Die Begrenzung der Wirtschaft hat genauso katastrophale Folgen wie ihr Wachstum oder dessen Beschleunigung.
Solange wir eine Lösung systemimmanent suchen, solange bleiben wir in dieser ausweglosen Situation gefangen. Wir können uns aus diesem Dilemma nur befreien, wenn wir das Wirtschaftssystem selbst in Frage stellen und nach einer alternativen Ökonomie suchen, die nicht wachstumsabhängig ist. Sind wir nicht bereit, das herrschende Wirtschaftssystem aufzugeben, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als weiterhin auf Wirtschaftswachstum zu setzen, auch wenn dies keine tragfähige Lösung ist. So betreibt der Staat notgedrungen Wachstumspolitik, vor allem angesichts chronisch niedriger Wachstumsraten. Der Staat erhöht einmal mehr seine Ausgaben, alles in der Hoffnung, dass sich das Wirtschaftswachstum kräftig erholt, damit es leistet, was es in der Vergangenheit so oft geleistet hat: steigende Einkommen und mehr Beschäftigung, sprudelnde Steuereinnahmen und prall gefüllte Sozialkassen. Mittlerweile lehrt aber die Erfahrung, dass das Wachstum trotz aller Anstrengungen weit geringer ausfällt als früher. Folglich nimmt der Staat weniger ein als geplant, zumal über die Finanzpolitik die Unternehmen gleichzeitig entlastet wurden. Der Staat bleibt so auf seinen Schulden sitzen. Wir befinden uns im so genannten schuldenfinanzierten Wachstum: Der Staat gibt ständig mehr Geld aus, wirft gutes schlechtem hinterher und verausgabt sich immer mehr. Der Staat läuft Gefahr, an diesem Aderlass zu verbluten.
Andererseits nimmt Wachstumspolitik immer mehr den Charakter einer Laissez-Faire-Politik an. Die Marktkräfte werden entfesselt durch Deregulierungen, Bürokratieabbau und abnehmende staatliche Kontrolle. Diese Politik begünstigt die Bemühungen und Anstrengungen der Wirtschaft, ihrerseits Wachstum zu forcieren, auch wenn die Märkte gesättigt sind. Die Sättigung wird ignoriert und deren Aufnahmefähigkeit ausgedehnt. Konsumenten werden gedrängt und mittels einer gigantischen Werbe- und Marketingmaschinerie verführt, mehr zu kaufen als sie benötigen; auch mehr als sie sich leisten können – mit der Konsequenz, dass sich private Haushalte verschulden. Helmut Schmidt hat darauf hingewiesen, dass die Gewinne vieler Unternehmen mittlerweile mit der Verschuldung der Massen bezahlt werden. (Helmut Schmidt, Wie entkommen wir der Depressionsfalle, DIE ZEIT, 15.1.2009, Nr. 4, Seite 1). Wirtschaftswachstum verkommt zu Scheinwachstum: der Wohlstand der einen wächst auf Kosten des anderen. Kein Wunder, dass fast überall die Einkommensschere aufgeht und sich immer mehr Vermögen in den Händen weniger konzentriert. Besonders drastisch zeigt sich das in den USA: „Für die Reichen ist es gut gelaufen. Seit Jahrzehnten steigen ihre Einkünfte, und ihre Aktienportfolios gewinnen an Wert. Wenn ein Amerikaner in den siebziger Jahren ein Vermögen von 75 Millionen Dollar hatte, schaffte er es damit auf die Liste der 400 reichsten Menschen des Landes, die das Magazin Forbes jedes Jahr zusammenstellt. 2007 benötigte man dafür mehr als eine Milliarde Dollar. Weniger gut ist es für die Ärmeren gelaufen. Der Jahreslohn eines mittleren, männlichen amerikanischen Arbeiters lag zuletzt bei 45.113 Dollar. Bereinigt um die Inflation, ist das sogar etwas weniger als in den siebziger Jahren. Damals hat so ein mittlerer Arbeiter 45.879 Dollar verdient.“ (DIE ZEIT, online, 20.08.2009, Nr. 35, Ist Wachstum nur für Ungleichheit zu haben?, Seite 1, www.zeit.de/2009/35/Ungleichheit).
Die Eroberung neuer Märkte ermöglicht ebenfalls zusätzliches Wachstum. Durch verstärkten Export wird die heimische Produktionskapazität ausgelastet und womöglich gesteigert. Eine Exportnation wie Deutschland hätte schon längst negatives Wachstum ohne seine Absatzmöglichkeiten im Ausland. So gesehen bedeutet Export nichts anderes als die eigenen Wachstumsprobleme anderen Ländern aufzubürden. So hat sich Griechenland unter anderem deshalb verschuldet, weil Deutschland und andere Länder ihm mehr verkauft haben, als es sich leisten konnte. Hier wiederholt sich zwischen Staaten, was sich zwischen Staat und Kapitaleigner, zwischen “unten” und “oben” abspielt: der Wohlstand des einen geht zu Lasten des anderen.
Wirtschaftswachstum ist ein Mittel zur Profitmaximierung. Sind diesem in der Realwirtschaft Grenzen gesetzt, so wendet man sich dem reinen Geldgeschäft zu, bei dem ohne den Umweg über die Produktion von Gütern und Dienstleistungen Geld zu mehr Geld gemacht wird. Nirgendwo sonst ist das Wachstum so ausgeprägt und nirgendwo sonst werden so hohe Renditen erzielt wie bei den Transaktionen auf den Finanzmärkten. Diese Renditen sind deshalb so enorm, weil die “Investitionen” dazu dienen, große Preisdifferenzen zu bewirken und diese als Gewinne einzustreichen. Diese Preisdifferenzen werden produziert durch Spekulation, Marktmacht, Manipulation, zeitlichen Vorsprung gegenüber anderen Marktteilnehmern mittels dem Einsatz modernster Technik (zum Beispiel high-frequency trading), Informationsvorsprung und Insiderwissen, Beeinflussung von Ratings und Abwicklung von Finanzgeschäften außerhalb des offiziellen Börsengeschehens. Doch dieses Wachstum ist auf Sand gebaut; irgendwann platzt die Blase, das Wachstum löst sich in Luft auf, die Preise stürzen ins Bodenlose und die Verluste schießen in die Höhe.
Die Bemühungen um Wirtschaftswachstum – sei es finanzmarktinduziertes, konsuminduziertes oder schuldenfinanziertes – bewirken letztlich das Gegenteil dessen, was sie beabsichtigen: statt allgemeiner Wohlstandsmehrung kommt es zu einer Einkommensumverteilung von unten nach oben; statt weiteren Vollerwerbsarbeitsplätzen handeln wir uns prekäre Beschäftigungsverhältnisse ein; statt dass die öffentlichen Haushalte ausgeglichener werden, nimmt die öffentliche Verschuldung zu; statt wirtschaftlicher Prosperität kommt es zu Finanz- und Wirtschaftskrisen.
Wirtschaftswachstum, ob positiv oder negativ, verursacht Krisen; versuchen wir es zu fördern, handeln wir uns ebenfalls handfeste Probleme ein. Das Prinzip Wirtschaftswachstum hat in jeglicher Hinsicht ausgedient. Dass wir gezwungen sind, Wachstum zu erzwingen liegt daran, dass wir von einem Wirtschaftssystem abhängig sind, das auf Wachstum angewiesen ist. Wollen wir einen wachstumsbedingten Kollaps vermeiden, braucht es ein neues Wirtschaftssystem, das ohne Wachstum auskommt.
Die Macht der Wirtschaft und die Ohnmacht der Öffentlichkeit
Solange wir von der herrschenden Wirtschaft erwarten, dass sie reichlich Früchte tragen und für alle abwerfen soll, dass sie letztlich unser Glück produziere, solange machen wir uns von ihr abhängig. Diese Abhängigkeit bekommen wir auf unterschiedliche Weise zu spüren: die Wirtschaft setzt beispielsweise all ihre Forderungen durch mit dem Hinweis, dass ansonsten die Wettbewerbsfähigkeit leide, der Wohlstand gefährdet sei und vor allem und wieder, dass Arbeitsplätze verloren gehen. Der Öffentlichkeit bleibt gar nichts anderes übrig als nachzugeben, will sie nicht Gefahr laufen, diese Nachteile in Kauf zu nehmen. Mit anderen Worten: wir sind erpressbar. Die Macht der Wirtschaft zeigt sich des weiteren darin, dass vor allem die global agierende Unternehmen (TNU) das Prinzip des Wettbewerbs umkehren: nicht sie konkurrieren um die besten Standorte, sondern die Standorte müssen um sie buhlen; nicht der Staat bestimmt die Rahmenbedingungen, denen sie sich anzupassen haben, sondern umgekehrt, die Wirtschaft diktiert die Rahmenbedingungen, die ihrem Wohlergehen genehm sind; nicht die Wirtschaft konkurriert so sehr um Arbeitnehmer, sondern diese schlagen sich darum, einen Job bei den Unternehmen zu ergattern. Doch nichts kann es mit der Macht und Unverfrorenheit der Finanzmärkte aufnehmen, diesem “merkwürdig gesichtslosen Wesen aus Banken und Börsen, Hedgefondsstrategen und Versicherungsmanagern, aber auch Pensionsfonds und Kleinanlegern.” (Der Spiegel, Welt am Abgrund, Nr. 32/2011, S. 63). Die Finanzmärkte handeln nicht nur mit Derivaten, sie sind selbst ein Derivat. Einst geschaffen, der Realwirtschaft zu dienen, haben sie sich zur Metawirtschaft erhoben, die den Spieß umgedreht und die Realwirtschaft zum Spielball ihrer eigenen Interessen gemacht hat: Die Finanzmärkte “diktieren die Bedingungen der Restökonomie. ….Die Dynamik des Finanzkapitals hat die Renditeerwartungen für die produzierende Industrie, für Gütermärkte und Dienstleistungen erhöht und die Durchsetzung von Wettbewerbsgesellschaften forciert.” (ZEIT online: Interview mit Joseph Vogl: “Was wir jetzt lernen müssen”, 14.8.2011, Seite 2 und3, www.zeit.de/2011/33/Finanzkrise-Interview-Vogl). Nichts ist der Finanzwirtschaft heilig. Mit allem, was sie zwischen die Finger bekommt, wird spekuliert: mit Aktien, Rohstoffen, Währungen, Unternehmen, Immobilien und neuerdings gegen Staaten. Wie im Casino wird gewettet, gezockt und geblufft, was das Zeug hält und ohne Rücksicht auf Verluste. So wurde der Immobilienboom in den USA benutzt, wenn nicht entfacht, um an den Finanzmärkten Spekulationsgeschäfte in milliardenfachem Umfang zu tätigen, die zunächst zu sagenhaften Gewinnen an den Börsen führten. Freilich war es nur eine Frage der Zeit, wann der ganze Hokuspokus in sich zusammenbrach. Der Umgang mit dem sich daraus ergebenden Desaster, Finanzkrise genannt, zeigte überdeutlich, wie mächtig die Finanzmärkte mittlerweile gegenüber dem Staat geworden sind: obwohl sie dieses Fiasko verursachten, wurde sie nicht zur Rechenschaft gezogen; nicht sie trugen die Verluste, die sich bei ihnen auftürmten, da sie sich kurzerhand für „systemrelevant“ erklärten, sondern die Öffentlichkeit; nicht die Finanzbranche übernahm die Verantwortung für ihr verantwortungsloses Handeln, sondern der Staat.
Doch damit nicht genug: diese Finanzbranche, die gerade von den Staaten gerettet wurde, profitiert nun in mehrfacher Hinsicht an ihrer eigenen Rettung: einerseits finanziert sie die Kredite, die die Staaten zur Überwindung der Finanzkrise aufnehmen müssen. Andererseits inszeniert sie aus der öffentlichen Verschuldung eine Staatsschuldenkrise, die die Kreditzinsen für verschuldete Staaten steigen lässt. Da es nicht gelang, die Finanzmärkte auch nur minimal kürzer als bisher an die Leine zu nehmen, was ein weiteres Indiz für ihre Macht ist, werden jetzt, wie seinerzeit mit den Hypotheken aus dem US-Immobilien-Geschäft, mit den Staatspapieren Derivate in großem Stil geschaffen, aus denen wiederum Spekulationsgewinne gezogen werden. Kam es seinerzeit zu einer „Immobilien-Blase“ wird hier eine „Staatspapier-Blase“ entstehen, die in einer zweiten Finanzkrise enden wird. Dann wird man erneut die Staaten bitten, die Suppe auszulöffeln, die sich die Finanzbranche eingebrockt hat. Doch dieses Mal treffen Finanzkrise und Staatsschuldenkrise aufeinander. Die Staaten können nicht noch einmal die Finanzbranche retten und diese wird Not leidenden Staaten keine Kredite mehr gewähren. Finanzinstitute drohen genauso bankrott zu gehen wie Staaten.
Die Tatsache, dass sich der Staat nicht als “systemrelevant” erklären kann, der “too big to fail” ist und der insofern zu schützen und zu retten wäre, bedeutet nichts anderes, als dass die Politik gegenüber der Finanz-Wirtschaft noch ohnmächtiger ist als gegenüber der Realwirtschaft. Es ist eindrucksvoll und erschreckend zugleich mit anzusehen, wie problemlos die Finanzmärkte mit dem Schicksal ganzer Staaten spielen. Dazu gehört auch die Ungeheuerlichkeit, wonach Staaten beweisen müssen, dass sie das Vertrauen der Finanzmärkte verdienen und nicht umgekehrt. Sogar Managern großer Industrieunternehmen wird es da ganz mulmig zumute: “Franz Fehrenbach: Ich war gerade in Japan und China. Auf dem Rückflug las ich von der Empfehlung einer US-Bank, deren Kunden nun auf den Niedergang Europas wetten sollen…
ZEIT: Sie meinen Goldman Sachs.
Fehrenbach: Ja. Wenn ich auf den Niedergang Europas wette, um eine hohe Rendite zu erzielen, finde ich das unerträglich und unmoralisch. Bei so einem Verhalten dreht sich mir, gelinde gesagt, der Magen um.” (Bosch-Chef Franz Fehrenbach über ungezügelte Finanzmärkte, politisches Versagen und unternehmerische Verantwortung im Interview: DIE ZEIT, “Mir dreht sich der Magen um”, Nr. 39 / 22.09.2011, Seite 31). Wer hätte gedacht, dass einmal ein Industriemanager sich moralisch über den Kapitalismus so empört, wie das sonst nur “Linke” tun.
Doch die Ökonomie ist mittlerweile nicht nur mächtig in dem Sinne, dass sie auf ihrem Feld ihre Interessen gegenüber der Politik problemlos durchsetzen kann, es werden auch immer mehr Lebensbereiche (Bildung, Kultur und Soziales) ökonomisiert und politische Entscheidungen von der Ökonomie diktiert. Oder wie es der Kulturwissenschaftler Vogl ausdrückt: “Es geht nicht bloß um die Bewältigung ökonomischer Probleme, es herrscht vielmehr ein Kampf um den Ort und die Verteilung politischer Entscheidungsmacht.” (ZEIT ONLINE: Interview mit Joseph Vogl: “Was wir jetzt lernen müssen”, 14.8.2011, Seite 8, www.zeit.de/2011/33/Finanzkrise-Interview-Vogl).
Die Macht der Ökonomie manifestiert sich des weiteren darin, dass sie ihre Gewinne privatisieren und die Verluste sozialisieren kann – zuletzt nach der Finanzkrise in großem Stil praktiziert. Die Finanzbranche machte sich zur „good bank“ und den Staat zur „bad bank“: Doch diese Funktion hatte der Staat bereits davor inne: die Wirtschaft wälzt schon lange unliebsame Probleme auf den Staat ab und lässt diesen mit deren Bewältigung allein. So wie beispielsweise Atommüll auf Kosten der Allgemeinheit entsorgt wird, so werden überflüssige Mitarbeiter auf dem Arbeitsmarkt „entsorgt“, für deren Kosten ebenfalls die Allgemeinheit aufzukommen hat. In dieser Funktion als Mülldeponie gleicht der Staat übrigens der Umwelt. Umwelt und Staat werden gleichermaßen von der Wirtschaft “verschmutzt”: was hier die Umweltverschmutzung ist, ist dort die Staatsverschuldung. Übrigens gibt es noch eine Parallele: Beide werden gleichermaßen als Steinbruch von der Wirtschaft „benutzt“: was bei der Umwelt die Rohstoffausbeute ist, ist beim Staat das Abgreifen von Subventionen, Beihilfen, Steuergeschenken und Konjunkturfördermitteln. Krisen in Staat und Umwelt sind daher kein Wunder.
Die Macht der Ökonomie erkennt man auch daran, dass sie in der Not den Staat als Retter verpflichten kann. Im Sinne der Marktlogik ist das natürlich äußerst inkonsequent, denn die Verfechter des Marktes weisen daraufhin, dass dieser es alleine richten wird, dass er mit Selbstheilungskräften ausgestattet sein und sich der Staat deshalb grundsätzlich herauszuhalten habe. Wie belastbar diese Versicherungen waren, konnte man im Zuge der Finanzkrise erleben: Von Selbstheilungskraft keine Spur; vielmehr war die Selbstzerstörung der Märkte so gewaltig, dass nicht mehr länger das hohe Lied des „Laissez-faire“ gesungen wurde, sondern der Gesang nahtlos überging in einen Hilfeschrei nach dem Staat , um das Schlimmste zu verhindern.
Die Wirtschaft ist ihrem Wesen nach zutiefst egoistisch und so verhält sie sich gegenüber dem Staat. Dieser Umstand alleine reicht schon aus, den Staat in Bedrängnis zu bringen. Doch kommt noch erschwerend hinzu, dass mittlerweile nicht nur die Wirtschaft, sondern weite Teile der Gesellschaft “ökonomisch denken und handeln” und sich ihrerseits egoistisch gegenüber dem Staat verhalten: Privatpersonen, Beamtentum wie öffentlicher Dienst, Arme wie Reiche. Anspruchsdenken und Versorgungsmentalität, Selbstgefälligkeit und Selbstgerechtigkeit, Unaufrichtigkeit und Verantwortungslosigkeit, Schwarzarbeit, Korruption und Steuerhinterziehung melken den Staat wie eine Kuh. Griechenland als Spitze des Eisbergs zeigt, was passiert, wenn es mit dem allgemeinen Egoismus übertrieben wird.
Unabhängigkeit vom herrschenden Wirtschaftssystem
Wachstumsbegrenzung ist keine Lösung, wie wir gesehen haben. Auch das Drehen an anderen Stellschrauben des Wirtschaftssystems reicht nicht aus: es wäre lediglich ein Kurieren an Symptomen, die bald wieder auftauchten oder die durch andere abgelöst würden. Wollen wir uns aus der Umklammerung des Wirtschaftssystems befreien, müssen wir uns von ihm unabhängig machen. Unabhängigkeit braucht eine Alternative, die an die Stelle des Bisherigen tritt. Um dies an einem aktuellen Beispiel zu demonstrieren: Wir könnten nicht aus der Atomkraft “aussteigen”, wenn wir nicht alternativ Strom zu erzeugen wüssten. Folglich benötigen wir ein alternatives Wirtschaftssystem, damit wir uns vom herrschenden befreien können. Diese Alternative fordert eine Bereitschaft zur Veränderung. Denn sie verlangt von uns, dass wir in Zukunft anders wirtschaften, anders arbeiten, anderen Werten folgen, d.h. anders leben werden. Das ist für viele eine Zumutung. Denn wir hätten einerseits Gewohntes und Vertrautes aufzugeben, auf Vorteile und Bequemlichkeiten sowie Ansprüche und Sicherheiten zu verzichten. Andererseits wäre Neuland zu betreten: so müssten neue Formen des Wirtschaftens und Arbeitens gelernt, ein- bzw. ausgeübt werden. Eine Zumutung, von der wir gegenwärtig (noch) nichts wissen wollen. Lieber machen wir so weiter wie bisher, hoffen dass doch alles gut ausgeht. Oder wir geben uns der Illusion hin, die Vorteile der florierenden, konkurrenzfähigen, effektiven und effizienten Wirtschaft irgendwie organisieren zu können, ohne deren Nachteile für Mensch, Gesellschaft und Umwelt länger in Kauf nehmen zu müssen: so soll die Volkswirtschaft auf Wachstum verzichten, Unternehmen auf Wettbewerb und Profitmaximierung, Manager und Unternehmer auf unmoralisches Verhalten, die Wirtschaft überhaupt soll von ihren egoistischen Interessen absehen und lieb und brav der Gesellschaft dienen. Genau von dieser Güte sind auch die Vorschläge zur „Begrenzung“ der Wirtschaft all der vermeintlichen Vordenker und Möchtegern-Visionäre: Man glaubt tatsächlich, das Wirtschaftssystem mit seinen Vorteilen, aber ohne seine Nachteile haben zu können Welch ein bequemes Denken, welche Verkennung, sich den Kapitalismus als ein System zurecht zu phantasieren, das uns eine Zukunft bescheren könnte, in der Friede, Freude, Eierkuchen herrschen.
Nein, so einfach ist es nicht. Die Herausforderung besteht schon darin, dass wir uns ein neues Wirtschaftssystem geben müssen, das von uns größere Veränderungen verlangt. Denn es führt kein Weg an der Einsicht vorbei, dass sich das herrschende Wirtschaftssystem überlebt hat. Seine Ausdehnung, vor allem die so genannte Globalisierung, sollte weniger als Siegeszug verstanden werden als vielmehr der Anfang seines Endes, als eine späte Entwicklungsstufe, auf die der Verfall folgen wird. Gleich einem Stern, dessen Lebenszyklus sich zu Ende neigt, dehnt sich das Wirtschaftssystem aus und wird zum weißen Riesen. Doch der Zeitpunkt naht, bei dem die größte Ausdehnung erreicht wird und kippt: dann ist der Zusammenbruch der herrschenden Ökonomie unvermeidlich. Deshalb gilt: zu einer Alternative gibt es keine Alternative; auch wenn der Neoliberalismus, d.h. die Radikalisierung des ökonomischen Denkens uns ständig einzubleuen versucht, dass es zu ihm keine Alternative gäbe. Wir brauchen einen neuen Stern – wir brauchen ein neues Wirtschaftssystem.
II Warum wir ein neues Arbeitssystem brauchen
Missstände im herrschenden Arbeitssystem
Das herrschende Arbeitssystem ist von vielen Missständen gekennzeichnet. Als erstes ist die Beschäftigungslosigkeit zu nennen; sie begleitet uns dermaßen lange, so dass wir uns fast schon an sie gewöhnt haben wie an eine chronische Krankheit. Häufig wird sie mit dem gleichgesetzt, was man die Krise der Arbeit nennt. In Wirklichkeit ist sie nur die Spitze des Eisbergs, dessen größerer Teil sich unter der Meeresoberfläche befindet. Weniger sichtbar, aber deutlich im Trend liegt die Verschlechterung der Arbeitsbedingungen. Damit sind vor allem die prekären Beschäftigungsverhältnisse gemeint. Bei ihnen handelt es sich um schlecht bezahlte, unsichere, weil leicht kündbare und häufig zeitlich beschränkte Jobs. Zu ihnen gehören unfreiwillige Teilzeitarbeit, Leih- und Zeitarbeit, befristete oder geringfügige Beschäftigung bis hin zu den „working poor“ und im weiteren Sinne auch Existenzgründungen aus Not, von denen man mehr schlecht als recht leben kann.
Mehrarbeit ist eine weitere Form dieser Verschlechterung. Einerseits nimmt die Produktivität des Einzelnen zu, andererseits wachsen die Überstunden der Arbeitnehmer. Man sollte meinen, dass in Zeiten von Beschäftigungslosigkeit die Überstunden abnehmen und gegen null tendieren zugunsten zusätzlicher Beschäftigungsverhältnisse. Doch weit gefehlt – es verhält sich gerade anders herum: die Menschen, die im Jobsystem sind, arbeiten sich halb zu Tode, während jene, die außen vor sind, vor Langeweile umkommen. Das führt übrigens zu der scheinbar paradoxen Erscheinung, dass, wer keinen Job hat, genauso unzufrieden ist wie der, der einer Beschäftigung nachgeht. Zumal die Unzufriedenheit im Job durch Über- oder Unterforderung, Erfolgsdruck und gesteigerte Leistungsanforderung verstärkt werden kann.
Des Weiteren wird es immer schwieriger, wenn nicht unmöglich, eine berufliche Identität auszubilden. Wir sprechen und tun zwar noch so, als ob dies der Fall sei, doch wir sitzen da einer Denkgewohnheit auf. In Wirklichkeit verweigert sich die Identitätsbildung durch Arbeit, weil in der Arbeitswelt in der Regel kein Beruf mehr ausgeübt wird, sondern ein Job zu erledigen ist (Vgl. hierzu: Gerd B. Achenbach: „Das Geld, der Beruf, der Individualismus. Warum Menschen Arbeit suchen“, Festvortrag auf dem Jubiläumskongreß 40 Jahre Deutscher Verband der Berufsberatung in Bad Godesberg am 5. Oktober 1996). Ein Job aber ist die Ausübung einer Funktion in einem Produktionsprozess, der hierfür die Arbeitskraft des Menschen instrumentalisiert. Außerdem wird die Identitätsbildung verhindert, weil viele Menschen einer Arbeit aufgrund der Beschäftigungslosigkeit schlichtweg nicht nachgehen können, und der mögliche Verlust des Arbeitsplatzes lässt an die Stelle der Identität die Angst um den Job treten.
Die prekäre Arbeitsmarktsituation bringt einen entsprechend hart geführten Konkurrenzkampf um Arbeitsplätze mit sich, insbesondere um die knappen Vollerwerbsarbeitsplätze. An die Stelle der freien Berufswahl ist ein Verdrängungswettbewerb getreten, bei dem es darum geht, ob man einen Job hat oder nicht, ob man “drinnen” oder “draußen” ist. Angesichts der Flut von Bewerbungen hat nicht der Arbeitnehmer, sondern der Arbeitgeber die Wahl, was ihm erlaubt, höhere Anforderungen zu stellen: er verlangt höhere Bildungsabschlüsse, bessere Zeugnisse, Zusatzqualifikationen, mehr Leistungsbereitschaft und dergleichen mehr. Der Arbeitsmarkt nimmt darüber hinaus den künftigen Arbeitnehmer bzw. Arbeitssuchenden immer stärker und früher als bisher in Beschlag: der lange Arm des Arbeitsmarktes reicht schon weit in die Schule hinein. Bildung und Erziehung richten ihre Inhalte stärker an ihm aus und Schüler lernen bereits früh, sich an den Anforderungen des Arbeitsmarktes zu orientieren. Der Aufwand, der für einen Arbeitsplatz betrieben werden muss, nimmt zu, während der Job, den man ergattert, immer weniger hält, was er verspricht.
Faktoren, die zu den Missständen führen
Rationalisierung der Arbeit
Die technologisch-ökonomische Entwicklung ermöglicht vor allem in den entwickelten Industrienationen eine zunehmende Rationalisierung der Arbeit. Jede neue Generation an Technologie dringt tiefer in Bereiche der Arbeit vor, die der menschlichen Arbeit bis dahin vorbehalten war. Die Rationalisierung bedingt, dass menschliche Arbeitskraft durch technologische Arbeitskraft ersetzt wird. Mit dem Ergebnis, dass immer mehr volkswirtschaftliches Vermögen mit immer weniger Menschen hergestellt werden kann.
Globalisierung der Arbeit
Im Zuge der Globalisierung der Ökonomie entsteht ein weltweiter Arbeitsmarkt, der Missstände des Jobsystems in die Welt trägt: international tätige Unternehmen lassen überall auf der Welt produzieren und arbeiten. Dies erlaubt ihnen, bisherige Betriebsbereiche outzusourcen oder gleich ganze Produktionsstätten von einem Land ins andere zu verlagern – so wie das beispielsweise Nokia vor einiger Zeit getan hat, indem die Firma ihre Zelte in Deutschland abbrach und in Rumänien wieder aufschlug. Dort, wo sich die multinationalen Unternehmen niederlassen, werden neue Arbeitskräfte rekrutiert. Dort, wo sie weggehen, werden die bisherigen Arbeitskräfte freigesetzt, verschwinden aber nicht vom Arbeitsmarkt, sondern verwandeln sich in Jobsuchende. Die Arbeit in dem einen Land bedeutet die Arbeitslosigkeit im anderen.
Die multinationalen Unternehmen wählen ihre Standorte nach den für sie günstigsten Produktionsbedingungen aus. Da die Personalkosten hierbei ein wichtiges, wenn nicht ausschlaggebendes Auswahlkriterium sind, haben Billiglohnländer einen unwiderstehlichen Vorteil. Produktion und Beschäftigung wandern von Hochlohnländern in Niedriglohnländer ab. Doch auch das Land, das den Zuschlag erhielt, kann sich diesem nicht dauerhaft sicher sein: sollte sich herausstellen, dass in irgendeinem Land die Arbeitskosten noch billiger sind als in ihm, wird die “mobile Fabrik” wieder abgebaut. So zieht die Karawane der globalen Ökonomie weiter und weiter, denn irgendwo auf der Welt gibt es immer jemand, der seine Arbeitskraft noch billiger anbietet. So werden allmählich Löhne und Gehälter global nach unten gedrückt. Diese Prekarisierung der Arbeit wird verstärkt, indem viele Länder sich gezwungen sehen, Unternehmen mit arbeitgeberfreundlicher Arbeits- und Sozialgesetzgebung anzulocken.
Landflucht
Mehr als eine Ursache raubt dem Leben auf dem Land weltweit die Perspektive und zieht ihm den Boden unter den Füßen weg: ob es die Agrarindustrie bzw. die global agierenden Agrarkonzerne sind, die der lokalen Landwirtschaft das Leben schwer machen; ob es die Spekulationen auf Lebensmittel sind, die massenhaft kleine Bauern in den so genannten Entwicklungsländern in die Armut stürzen; sei es der Zwang zu Verelendungswachstum, in dem viele Landwirtschaftsbetriebe stecken und der für kleine Betriebe das Aus bedeutet oder die Resignation im Kampf um Marktanteile gegenüber allzu mächtigen Marktteilnehmern. Tatsache ist, dass weltweit eine enorme Landflucht im Gange ist, die die Menschen in die Städte treibt, in der Hoffnung auf ein besseres Leben. So strömen Abermillionen Arbeitsmigranten vor allem in die Megastädte dieser Welt, wo sie in den wachsenden Slums, Ghettos und Wellblechbehausungen unter erbärmlichsten Lebensbedingungen das Heer der Arbeitssuchenden vergrößern. Sie sind gezwungen, jeden noch so schäbigen Job zu machen, für den der Ausdruck “prekäres Beschäftigungsverhältnis” nichts anderes ist als ein unverschämter Euphemismus. Kein Ökonom dieser Welt vermag die Frage zu beantworten, wie für diese Massen Jobs, geschweige denn sichere, gut bezahlte Vollerwerbsarbeitsplätze geschaffen werden können. Dabei ist noch nicht berücksichtigt, dass das Gros der Landbevölkerung, die immerhin bis zur Hälfte der Weltbevölkerung ausmacht, sich noch nicht in Bewegung gesetzt hat. Dies ist aber nur eine Frage der Zeit, falls es für die Menschen im ländlichen Raum keine Perspektive gibt, die es ihnen ermöglicht zu bleiben.
Bevölkerungswachstum
Um sich ein Bild von der schieren Größenordnung zu machen, die das Anwachsen der Weltbevölkerung bedeutet, sei daran erinnert, dass diese von Anfang des 20. Jahrhunderts mit ca. 1,5 Milliarden Menschen auf ca. 6. Mrd. Menschen bis Ende des 20. Jahrhunderts angewachsen ist. 2050 werden es wohl 9 Mrd. Erdenbürger sein. (Quelle: Atlas der Globalisierung, Le Monde diplomatique Herausgeber, Seite 52, 2003, Berlin). Eine Konsequenz ist, dass das globale Bevölkerungswachstum tagtäglich Menschen auf den globalen Arbeitsmarkt wirft, auf dem sich eh schon viel zu viele Arbeitskräfte tummeln. Die Zahl der Arbeitssuchenden schießt regelrecht nach oben; die Nachfrage nach Arbeitskräften ist diesem Ansturm nicht gewachsen und steht ihm hilflos gegenüber. Hoimar von Ditfurth hat diese Situation einmal vor Jahren für das Jahr 2000 illustriert, wonach wir alleine bis zu diesem Zeitpunkt “weltweit fast eine Milliarde zusätzliche Arbeitsplätze schaffen müßten, wenn wir verhindern wollen, daß die beiden Menschenmilliarden einfach ohne jede Hoffnung bloß existieren. Wir, und damit eines der reichsten Länder dieser Erde, sind seit etlichen Jahren nur noch mit größten Anstrengungen in der Lage, auch nur 200000 Jugendliche jährlich auf zusätzlichen Arbeitsplätzen unterzubringen. Wer sich darauf zum Vergleich besinnt, dem geht ein Begriff auf von der Hoffnungslosigkeit des Unterfangens, einer Menschenmenge, die mindestens 4000mal (!) so groß ist und deren größter Teil in den ärmsten Gebieten der Erde lebt, die gleichen Chancen zu verschaffen.” (Hoimar v. Ditfurth, So laßt uns denn ein Apfelbäumchen pflanzen: es ist soweit, Rasch und Röhring Verlag, Hamburg-Zürich, 1985, Seite 156). Natürlich hat sich an dieser grundlegenden Problematik seit dieser Zeit nichts geändert.
Fazit
Die Disfunktionalitäten des Jobsystems nehmen zu; schon jetzt sind manche Zustände und Zwänge eigentlich unzumutbar und unhaltbar. Doch die meisten von uns sind auf einen Job angewiesen, um sich ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Deshalb bleibt uns nichts anderes übrig als diese Verschlechterungen zähneknirschend in Kauf zu nehmen. Was für den Einzelnen gilt, gilt für die Gesellschaft als Ganzes. Dreh- und Angelpunkt der entwickelten wie sich entwickelnden Industriegesellschaften ist die Jobarbeit. Sind Jobs rar, bilden sich gesellschaftliche Rand- und Risikogruppen, Teile der Bevölkerung verarmen, die soziale Spaltung sowie die Kluft zwischen arm und reich nimmt zu. Jobarbeit ist der Kitt, der die Gesellschaft zusammenhält. Zerbröselt dieser, drohen ihr Zerreißproben. Der Staat, insbesondere der Sozialstaat, hängt ebenfalls vom Jobsystem ab. Denn die sozialen Sicherungssysteme speisen sich durch Beiträge und Abgaben aus der Arbeit: je weniger Jobs und je mehr prekäre Beschäftigungsverhältnisse, desto defizitärer werden die Sozialkassen. Da die Beiträge zur Sozialversicherung nicht beliebig erhöht werden können, ist der Sozialstaat gezwungen, die Defizite auszugleichen. Gleichzeitig büßt er bei der Lohn- und Einkommenssteuer ein, die in Ländern wie Deutschland eine Haupteinnahmequelle der öffentlichen Hand ist. Die Schere zwischen öffentlichen Ausgaben und Einnahmen öffnet sich unaufhaltsam. Angesichts der gesellschaftlichen Bedeutung und der Abhängigkeit vom Jobsystem setzt der Staat alles daran, Beschäftigung zu sichern, Beschäftigungslosigkeit abzubauen und neue Jobs zu schaffen. Das geht nicht ohne Wirtschaftswachstum. Die Abhängigkeit vom Jobsystem erhöht daher den Zwang zu Wirtschaftswachstum und vertieft damit die Abhängigkeit vom Wirtschaftssystem.
Doch wie wir wissen, fallen die Ergebnisse der Wachstumspolitik mehr als mager aus. Die staatlichen Maßnahmen, die ergriffen werden, haben weit weniger Beschäftigungseffekte als früher. Wie erklärt sich das?
Neue Arbeitsplätze entstehen durch Investitionen. Doch die Schaffung eines zusätzlichen Arbeitsplatzes kostet heute unvergleichlich mehr als früher. Der Staat müsste ein Vielfaches an früheren Fördermitteln für die Wirtschaft aufbringen um die gleiche Beschäftigungswirkung wie früher zu erzielen. Doch er verfügt ganz einfach nicht über die entsprechenden Mittel, um solche aufwendigen Investitionsprogramme aufzulegen. Das nächste Problem ist, dass ein Großteil der Investitionen in der Wirtschaft in Technologien fließt, die Arbeit rationalisieren und Arbeitskräfte überflüssig machen. Deshalb gehen heute Investitionen mit Beschäftigungsabbau einher. Anders gesagt: Wachstum beschleunigt die Rationalisierung der Arbeit, so dass deren negative Beschäftigungseffekte die positiven des Wachstums relativieren, wo nicht neutralisieren. Mehr noch: Wirtschaftswachstum und Beschäftigungslosigkeit werden zu gleichzeitigen Phänomen. Fast täglich kann man in der Zeitung Meldungen lesen über Wirtschaftswachstum, Umsatzzuwächse, Gewinnsteigerungen neben Berichten über Personalabbau, Rationalisierungsmaßnahmen und Kosteneinsparungen im Personalbereich: der Wirkungszusammenhang zwischen Wirtschaftswachstum und Beschäftigung hat sich umgedreht – und wo nicht, werden nicht so sehr Vollerwerbsarbeitsplätze, sondern überwiegend atypische Beschäftigungsverhältnisse geschaffen. Der Staat kann Massenbeschäftigungslosigkeit nicht durch Wachstumspolitik entscheidend reduzieren.
Die von staatlicher Seite betriebene Beschäftigungspolitik der “Deregulierung und Flexibilisierung der Arbeit” mag zwar mehr Jobs hervorbringen, allerdings haben davon viele prekären Charakter und können leicht wieder eingezogen werden, wenn die Konjunktur zurückgeht. Die Krise der Beschäftigung wird mit dieser Politik nicht entschärft, es wird nur ein Krisenphänomen durch ein anderes ersetzt.
Die Missstände im Jobsystem nehmen weltweit zu. Globalisierung, Landflucht und Bevölkerungswachstum lassen weltweit unzählige Menschen auf den Arbeitsmarkt strömen. Gleichzeitig hebt eine Rationalisierung der Arbeit im großen Stil an, die Arbeitskräfte freisetzt und diese zusätzlich auf den Arbeitsmarkt wirft, so dass es Arbeitskräfte wie Sand am Meer gibt. Es kommt zu nie da gewesener Beschäftigungslosigkeit, massenhaften prekären Beschäftigungsverhältnissen und einer Verschlechterung der Arbeitsbedingungen. Wirtschaft und Staat sind nicht in der Lage, diese Missstände zu beheben. Im Gegenteil: trotz aller Anstrengungen nehmen sie zu.
Wollen wir für ein immer schlechter funktionierendes Jobsystem, dessen Schäden irreparabel sind, nicht noch mehr Opfer aufbringen, dann bedürfen wir einer Alternative. Wir brauchen ein neues Arbeitssystem, das das alte Jobsystem ersetzt.
III Bedingungen für ein alternatives Wirtschafts- und Arbeitssystems
Kaum noch ein Land, das sich der Globalisierung des westlichen Wirtschafts- und Arbeitssystems entziehen könnte. Diese Tatsache verlangt von einem neuen Wirtschafts- und Arbeitssystem, will es eine wirkliche Alternative sein, dass es weder exklusiv ist (zum Beispiel für die reichen Industrieländer) noch begrenzt ist (für “die Entwicklungsländer“), sondern von Anfang an weltweit angewendet werden kann.
Ein neues Wirtschafts- und Arbeitssystem hat sich dadurch zu charakterisieren, dass es ohne Wachstum, aber auch ohne Wettbewerb, ohne die Herrschaft der Märkte, ohne Gewinnmaximierung, ohne Massenproduktion und Massenkonsum und ohne Jobarbeit als dominanter Arbeitsform auskommt. Denn nur dann kann es die die Zwänge, Probleme bzw. Verwerfungen überwinden, mit denen wir derzeit konfrontiert sind. Ein neues weltweit einzuführendes Wirtschafts- und Arbeitssystem hat so beschaffen zu sein, dass vor allem die Umweltbelastung entschieden reduziert wird; dass weit Ressourcen schonender gewirtschaftet wird als bisher; dass prinzipiell alle Menschen die Möglichkeit haben, durch menschenwürdige Arbeit sich materiell ausreichend zu versorgen; dass einerseits der Landflucht entgegengewirkt wird und andererseits das Leben in den Megastädten mit seinen wachsenden Slums und Ghettos so zu bewerkstelligen, dass es mehr als bloß zum Überleben reicht. Mit anderen Worten: dass es den Namen Nachhaltigkeit wirklich verdient.
Damit wäre schon viel erreicht, doch fehlt eine entscheidende Bedingung: Wenn das neue Wirtschafts- und Arbeitssystem nur in dem Sinne anders wäre, dass wir zwar anders als bisher für unseren Lebensunterhalt sorgen, unser Leben aber genauso wie bisher weitgehend von der „Notwendigkeit“ dominiert wäre, dann wäre letztlich wenig gewonnen. Wir wären weiterhin eingespannt zwischen Produktion und Konsum, das Wirtschaften wäre nicht Mittel zum Zweck, sondern Selbstzweck und bald würden sich erneut Auswüchse und Entartungen, wenn auch anderer Art einstellen. Immer mehr materielle Güter zu produzieren, anzuhäufen bzw. zu konsumieren ist kein Ziel an sich. Wirtschaften ist lediglich ein Mittel, um notwendige materielle Bedürfnisse zu befriedigen. Nicht mehr und nicht weniger. Unsere Wirtschafts- und Arbeitsgesellschaft hingegen kennt nur die “Notwendigkeit”. Ursprünglich angetreten, den Menschen aus der „Notwendigkeit“ zu befreien, hat sie diese verabsolutiert. Um es ganz unverblümt zu sagen: Unser herrschendes Wirtschafts- und Arbeitssystem ist der Inbegriff von Notwendigkeit. Höhere Ziele wie Freiheit sind ihr fremd. Freiheit fängt jedoch erst dort an, wo Notwendigkeit aufhört. Der Liberalismus trat zwar einmal an, persönliche Freiheit zu verwirklichen, faktisch hat er aber an die Stelle von personalen Abhängigkeiten und Zwängen die Abhängigkeit und den Zwang von anonymen Strukturen und Systemen gesetzt (sei es vom Wirtschaftssystem, vom Bildungssystem, vom Gesundheitssystem, vom Jobsystem und so weiter). Nicht die persönliche Freiheit hat sich eingestellt, sondern die Freiheit von Strukturen und Systemen wurde etabliert. So zielt der Wirtschaftsliberalismus auf die Freiheit der Märkte. Dann, so die Begründung, würden sie am besten funktionieren. Mittlerweile hat sich diese Denke radikalisiert: der so genannte Neoliberalismus will absolut freie Märkte. Das heißt: Der Markt soll ganz frei sein von äußeren Eingriffen; der Staat soll sich nie in Marktgeschehnisse einmischen; die Menschen sollen sich ganz den Marktbedingungen anpassen, den Marktgesetzen sich unterordnen und ihnen gemäß agieren. Die Freiheit der Märkte verlangt die Unfreiheit der Menschen. Wollen wir das nicht hinnehmen, so müssen wir uns vom Liberalismus und erst recht vom Neoliberalismus emanzipieren. Ein neues Wirtschafts- und Arbeitssystem hat also das Versprechen einzulösen, was das alte nicht gehalten hat: in befristeter Zeit eine materielle Lebensgrundlage zu schaffen, auf der sich ein “höheres, freies Leben” entfalten kann. Neben der „notwendigen Arbeit“ braucht es daher eine „freie Arbeit“ , die den Menschen, um bei der Begrifflichkeit zu bleiben, aus dem “Reich der Notwendigkeit” ins “Reich der Freiheit” führt.
Der Übergang vom alten zum neuen Wirtschafts- und Arbeitssystem kann nicht abrupt geschehen. So genannte “Schocktherapien” sorgen immer für große Verwerfungen, wenn nicht für Zusammenbrüche. Transformationsprozesse dieser Größenordnung gelingen am besten gleitend. Um ein aktuelles Beispiel aus der Energiepolitik zu nehmen: Der Ausstieg aus der Kernenergie geschieht nicht über nacht, um die Energieversorgung nicht zu gefährden, sondern nach und nach: so wie die alternative Energie gewonnen wird, so wird ein AKW nach dem anderen abgeschaltet. Genauso gilt es hier: So wie die Elemente des neuen Wirtschafts- und Arbeitssystems eingeführt werden, so werden die des alten relativiert, abgeschwächt, begrenzt und allmählich zurückgedrängt bis sie irrelevant werden oder punktuell noch dort beibehalten werden, wo sie für zweckmäßig erachtet werden. Bezüglich der Jobarbeit bedeutet das, dass sie nicht sofort abgeschafft wird, sondern die Jobarbeitszeit nach und nach reduziert wird.
Frithjof Bergmanns Konzept “Neue Arbeit” erfüllt diese Bedingungen wie kein anderer Ansatz. Deshalb wird die „Neue Arbeit“ im nächsten Kapitel als alternatives Wirtschafts- und Arbeitssystem vorgestellt:
IV Die Konturen des neuen Wirtschafts- und Arbeitssystems –
ein Plädoyer für das Konzept “Neue Arbeit – Neue Kultur “
Community Production
Community Production ist eine Form der lokalen Ökonomie, bei der sich Menschen Güter selbst herstellen mittelst adäquater Produktionstechnologie. Insbesondere Fabrikatoren und Automaten, die leicht handhabbar, leistungsfähig und multifunktional sind, ermöglichen es, sich selbst zu versorgen: „Wir könnten eine Reihe von Geräten, Apparaten, Materialien, Maschinen und Herstellungsarten entwickeln, die es uns oder einer nicht sehr großen Gruppe von Menschen ermöglichen würden, 60 bis 80 Prozent von dem, was wir zum Leben brauchen, selbst herzustellen.“ ( Die Ära Neue Arbeit, Interview mit Frithjof Bergmann, Focus, Nr. 24/1999, Seite 140).
Die Anwendung von Produktionstechnologie für eine auf Selbstversorgung basierende Wirtschaft ermöglicht “individuelle Produktion”: „An die Stelle riesiger Produktionshallen mit vielen Robotern treten vielseitigere einzelne Roboter, die individuelle Produktion erlauben. Sie schreinern nach unseren Entwürfen und Vorstellungen Stühle und Tische, nähen Kleider oder schneiden Autoteile zu.“ (Die Ära Neue Arbeit, Interview mit Frithjof Bergmann, Focus, Nr. 24/1999, Seite 140). Individuelle Produktion bedeutet, jeder Mensch stellt sich das her, was er für sich benötigt. Das heißt, Produktion und Konsum werden vom Menschen selbst bestimmt. Damit unterscheidet sich Community Production sowohl von der herkömmlichen Selbstversorgung als auch von der herrschenden Ökonomie mit ihrer industriellen Massenproduktion.
Die traditionelle Selbstversorgung ist dem Umfang nach “natürlich” begrenzt ist. Sie hat sich nach dem zu richten, was der Natur abgerungen werden kann. Es die Natur, die letztlich vorgibt, was und wie viel produziert und konsumiert werden kann. Insofern bedeutet die herkömmliche Selbstversorgung immer auch ein relativ bescheidener materieller Lebensstandard. Community Production kennt diese Art von Selbstgenügsamkeit nicht: vielmehr ist es das individuelle Bedürfnis des jeweiligen Menschen, das die Produktion bestimmt, d.h. sie dient der Befriedigung der individuellen Bedürfnisse. Community Production gewährleistet eine von den natürlichen Produktionsfaktoren unabhängige Herstellung. Was produziert werden kann hängt nicht von der Natur ab, sondern von der Technologie. Dank der technologischen Entwicklung ermöglicht Community Production eine unvergleichlich vielseitigere und anspruchsvollere Selbstversorgung als die herkömmliche:
-
Fabrikatoren sowie vernetzte Computer-Maschinen-Systeme ermöglichen sowohl die Herstellung von alltäglichen Gebrauchsgegenständen wie Kleidern, Schuhen, Geschirr, Haushaltsgeräten und Möbeln als auch von nicht alltäglichen Dingen wie Schmuck und Kunstgegenständen.
-
“Food-Häuser” sowie Verfahren wie Permakultur ermöglichen Lebensmittelproduktion in der Stadt. Menschen können sich dadurch auf einfache Weise mit Lebensmitteln selbst und vor allem preiswert versorgen.
-
Neue Bauweisen werden das Hausbauen weit mehr Menschen ermöglichen als dies zurzeit der Fall ist. Jetzt sind die eigenen vier Wände so teuer geworden, dass immer weniger sie sich leisten können; wer sie sich leistet, bürdet sich eine jahrzehntelange finanzielle Last auf, die so manchem zum Mühlstein um den Hals wird. Wohnen, das doch ein menschliches Grundbedürfnis ist, sollte aber für jedermann erschwinglich sein. Das wird erreicht, wenn man auf einfache Weise in Eigenregie bauen kann.
Der Einsatz von „High-Tech“ impliziert, dass Community Production kein Zurück zur Natur und damit kein Zurück zur schweren körperlichen Arbeit bzw. Muskelkraft ist. Vielmehr setzt Community Production modernste, fortgeschrittenste Technologie so ein, dass nicht der Mensch die Hauptlast der Arbeit trägt, sondern Maschinen. Im Gegensatz zur traditionellen Selbstversorgung ist Community Production eben nicht mühselig, erschöpfend und Kräfte zehrend, sondern schöpferisch, gestaltend, anregend und selbstbestimmt. Nicht die menschliche Arbeitskraft ist gefordert, sondern der menschliche Geist, der sich der Technologie bedient. Während die Selbstversorgung früherer Zeiten ohne viel Technologie auskommen musste bzw. aus ihrem Selbstverständnis heraus sich die Technologie weniger zu eigen macht als sie es könnte, stützt sich Community Production geradezu auf sie. Man kann es auch so ausdrücken: was für die klassische Selbstversorgung die Arbeitskraft ist, ist die Technologie für Community Production. Dies führt zu einer weiteren Unterscheidung: Während die traditionelle Selbstversorgung zeitraubend war und für anderes wenig Zeit ließ, will Community Production gerade die Herstellung des Notwendigen zeitlich begrenzen. Ein Beispiel, um das eben Gesagte zu illustrieren, ist die automatische Vollwaschmaschine. Während das Waschen zu früheren Zeiten eine mühselige Schufterei war, die nicht selten, vor allem im Winter, mehrere Tage in Anspruch nahm, ist das Waschen heute dermaßen zum Kinderspiel geworden, dass es kaum noch als Aufwand wahrgenommen wird. Die Wasch-Maschine hat die Arbeit des Waschens weitgehend übernommen und uns von ihr befreit. Deshalb ist sie aus dem Alltag einfach nicht mehr wegzudenken – auch der größte Technikfeind hat sie im Keller stehen und möchte sie nicht mehr missen. Die automatische Vollwaschmaschine zeigt, worauf es bei der Technologie ankommt: nämlich auf praktische und nützliche, effektive und effiziente Weise uns die notwendige Arbeit zu erleichtern und, wo möglich, abzunehmen.
Community Production und das herrschende Wirtschaftssystem unterscheiden sich fundamental und in jeglicher Hinsicht:
-
Community Production erwirkt wie jede Selbstversorgung die Einheit von Produktion und Konsum; unser Wirtschaftssystem hingegen trennt gerade diese beiden Bereiche, was eine Vermittlung durch Märkte nötig macht. Niemand ist in einem solchen marktwirtschaftlichen System autark, sondern alle hängen von allen und insbesondere vom Markt ab. Community Production zielt auf die wirtschaftliche Autarkie des Einzelnen ab. Das heißt, die Abhängigkeit von den Märkten wird aufgehoben und damit zugleich ihre Dominanz und die Zwänge, die sie auf uns ausüben.
-
Die jetzt herrschende Wirtschaftsform ist eine Privatwirtschaft, während Community Production eine „öffentliche Wirtschaft“ darstellt. Denn bei ihr sind die Produktionsmittel öffentliche oder quasi-öffentliche Güter in entsprechenden Einrichtungen. Denn nur dann ist gewährleistet, dass sie allen Menschen zugänglich sind und deren Nutzung für jedermann erschwinglich ist. Bei der Privatwirtschaft hingegen sind die Produktionsmittel in Privatbesitz. Dies macht die Masse der in diesem Sinne besitzlosen Menschen doppelt abhängig: zum einen sind sie von dem abhängig, was für den Konsum produziert wird. Sie selbst können nicht entscheiden, was produziert wird und was nicht. Zum anderen hängt ihre Arbeit von der Produktion ab, weshalb man auch von „abhängig Beschäftigten“ spricht. Ohne Produktion keine Arbeit; ohne Arbeitgeber keine Arbeitnehmer.
-
Es versteht sich von selbst, dass sich die Arbeit in beiden Wirtschaftsformen wesentlich unterscheidet. In der Privatwirtschaft arbeiten die Menschen für einen Dritten: für den Arbeitgeber, für den Markt, für die Produktion, für Geld usw. Community Production hingegen bedeutet, für sich selbst zu arbeiten.
-
Community Production findet in Selbstversorgungszentren statt, die im Gegensatz zu unseren jetzigen Unternehmen bzw. Fabriken klein sind. Das liegt zum einen daran, weil in diesen Zentren keine Massen produziert werden, sondern Einzelfertigung stattfindet; zum anderen ist die hierfür benötigte Produktionstechnologie multifunktional, so dass man nur wenige Maschinen benötigt.
-
Marktwirtschaft bringt unweigerlich Wettbewerb mit sich: so wie Unternehmen miteinander um Marktanteile konkurrieren, konkurrieren Menschen um Arbeitsstellen. Die Globalisierung der Ökonomie verschärft diesen Wettbewerb, dessen Zwängen sich die Menschen unterzuordnen haben. Dieser Wettbewerb entfällt bei Community Production, da jeder Mensch für sich selbst seine materielle Grundversorgung produziert – und dabei steht er nicht im Wettbewerb mit anderen.
-
Unser jetziges Wirtschaftssystem ist wachstumsorientiert bzw. wachstumsgetrieben und somit grenzenlos. Community Production hebt nicht nur die Trennung von Produktion und Konsum auf, sondern begrenzt sie auch. Während unsere Wirtschaft größtmögliche Stückzahlen produzieren will, orientiert sich „individuelle Produktion“ an kleinen Stückzahlen, wodurch Auswüchsen vorgebeugt wird. Selbstversorgung kennt keine Überproduktion, keine Blasen und daraus entstehende Finanz- und Wirtschaftskrisen, die derzeit unser Wirtschaftssystem erschüttern.
-
Massenproduktion und Massenkonsum belasten erheblich die Umwelt; jede ökologische Verbesserung eines Produkts wird neutralisiert durch dessen Mehrproduktion, die das Wirtschaftswachstum fordert; die Globalisierung der Ökonomie will den westlichen materiellen Lebensstil über die Erde verbreiten, was deren Belastung weit übersteigt. Community Production hingegen zeichnet sich durch Begrenzung der unterschiedlichsten Art aus, die der Umwelt zugute kommt: sie ersetzt die industrielle Massenproduktion durch Einzelproduktion; Massenkonsum weicht individueller Bedarfsdeckung; Wirtschaftswachstum ist für Community Production ein Fremdwort: nicht der absurd künstlich aufgebauschte materielle Lebensstil des Westens, nicht sein Konsumrausch wird in die Welt getragen, sondern eine individuell gestaltbare Grundversorgung. Da Community Production lokale Ökonomie ist, wird einerseits der immense globale Güterverkehr entschieden reduziert, der wesentlich zur Umweltverschmutzung beiträgt. Andererseits hebt sie die jetzt vorherrschende Trennung von Leben und Arbeiten auf, die sich mit dem Wirtschafts- und Jobsystem verbreitete. Dadurch wird das unselige, massenhafte Pendeln von und zur Arbeit weltweit reduziert, das ebenfalls weniger Umweltverschmutzung bedeutet. Davon abgesehen werden abertausende Staus vermieden, in denen wir unsere Zeit und Nerven sinnlos vergeuden.
-
Community Production geht von individuell begrenzten Bedürfnissen aus, folglich sind es Produktion und Konsum auch. Im Gegensatz dazu propagiert das herrschende Wirtschaftssystem grenzenlose Bedürfnisse, denen durch ständig steigende Produktion und Konsum zu begegnen ist. Das Einzige, was Massenproduktion und Massenkonsum dämpft oder begrenzt, ist das Geld. Es ist das Geld, welches wir zur Verfügung haben, das darüber entscheidet, was wir uns kaufen und somit konsumieren können. Ohne Geld könnten wir unsere Bedürfnisse nicht befriedigen, nicht dem Konsum huldigen, was sich sofort auf die Produktion auswirken würde. Entscheidend ist daher, dass Produzenten wie Konsumenten über ausreichend Geld verfügen bzw. auf zusätzliches Geld in Form von Kredit zugreifen können, dann steht der Steigerung der Produktion und des Konsums, monetär betrachtet, nichts im Wege.
-
Während das herrschende Wirtschaftssystem ganz vom Geld abhängig ist, verringert Community Production diese Abhängigkeit entscheidend: je mehr Menschen sich selbst versorgen, desto weniger Güter müssen sie kaufen; desto weniger Geld benötigt der Einzelne, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. An die Stelle des Geldverdienens und Geldausgebens tritt die Eigenproduktion. Des Kontrastes wegen bezeichnet Frithjof Bergmann deshalb die Ökonomie der „Neuen Arbeit“ als eine “Wirtschaft des minimalen Kaufens” im Gegensatz zur herrschenden Ökonomie, die er als eine “Wirtschaft des maximalen Kaufens” charakterisiert (Frithjof Bergmann, Neue Arbeit-Neue Kultur, Arbor-Verlag, 2004, S. 316).
Übrigens ist die Selbstversorgung preiswerter als der Kauf von Waren: oft wird zwar behauptet, dass Massenproduktion preiswerter sei als Einzelproduktion. Doch das ist ein “Mythos”: Der Großteil des Preises eines Produkts machen häufig nicht die Herstellungskosten, sondern andere Kosten wie Transport, Werbung, Verpackung, Lagerung, Vertriebsstruktur, Zwischenhandel und Overheadkosten aller Art aus. Diese entfallen alle bei der Eigenproduktion.
Eigenproduktion ist jedoch auch dort vorteilhaft, wo die Herstellungskosten hoch sind. Wer schon mal ein Haus gekauft hat, der weiß, wie teuer das ist. Wer dagegen sich sein Haus auf effektive und effiziente Art und Weise bauen kann, und genau das ist ja das Anliegen von Community Production, der wird die Kosten für das Eigenheim massiv reduzieren. Auf alle Fälle wird die Kostensenkung bzw. der Wert, der er sich durch Eigenarbeit schafft, mehr ausmachen als ein Durchschnittsverdiener in der gleichen Zeit durch seine Erwerbsarbeit an Geld verdienen kann. Zugleich spart der Selbstversorger so manche Nebenkosten, von denen die unverschämt hohen Maklergebühren die ärgerlichsten und unnötigsten sind.
Community Production ist ein ökonomischer Ansatz, der weltweit anwendbar ist, zumal er Lösungen für Probleme parat hält, auf die die herkömmliche Ökonomie keine Antwort hat: Community Production kann der weltweiten Landflucht entgegenwirken, da in jedem Dorf ein solches Selbstversorgungszentrum implementiert werden kann; sie kann in den zunehmenden Slums dieser Welt eine Grundversorgung ermöglichen, in denen reguläre Jobs Mangelware sind; und Community Production kann den Massen Arbeit geben, die angesichts der globalen Bevölkerungszunahme auf den Arbeitsmarkt strömen und dort keine Jobs finden.
Gesetzt den Fall, Community Production würde sich durchsetzen und die Weltbevölkerung könnte sich durch sie materiell ausreichend versorgen; angenommen, eine individuell bestimmbare Selbstversorgung ließe sich bei begrenztem Aufwand bewerkstelligen: Die Ökonomie wäre nicht mehr länger Selbstzweck, sondern Mittel für einen Zweck. Konkret: ihre Funktion würde darin bestehen, die notwendige Bedingung für „freie Arbeit“ zu schaffen.
Calling
Notwendige Bedingung für freie Arbeit ist, dass die materielle Lebensgrundlage gesichert ist. Solange man ausschließlich für diese arbeitet bzw. arbeiten muss, bleibt man in der “Notwendigkeit” stecken. Die Neue Arbeit gewährleistet diese materielle Unabhängigkeit mittels Community Production. Hinreichende Bedingung für freie Arbeit ist allerdings erst dann gegeben, wenn ein Mensch einem Calling nachgeht. Das heißt, wenn der Mensch sich mit einer Sache bzw. einem Thema identifiziert, das der Mensch zum Gegenstand seiner Arbeit schlechthin macht. Diese Identifikation spiegelt ein persönliches Anliegen, ein Interesse, einen Wunsch, eine Leidenschaft für eine Sache wider. Das Calling beruht daher auf einer persönlichen Beziehung zwischen einem Menschen und seiner Arbeit, der dieser einen hohen Wert beimisst. Wer sich mit seiner Arbeit identifiziert, erfährt Freiheit. Freiheit ist nach Bergmann eine Funktion von Identität – und die verlangt Beziehung und Bindung, Verantwortung und Treue, Hingabe und Zuwendung. Damit widerspricht Bergmann vehement dem gängigen Verständnis von Freiheit, wonach diese absolute Unabhängigkeit, Ungebundenheit, ein Leben ohne Grenzen und Hindernisse brauche oder sich darin ausdrücke, anders als die anderen zu sein. Freiheit meint auch nicht Wahlfreiheit, die sich unter anderem dadurch charakterisiert, dass man zwar zwischen vielen Jobs, nicht aber zwischen Jobs und freier Arbeit wählen kann. Nach Bergmann führt dieser herrschende Freiheitsbegriff in die Leere.
Freiheit, wie sie hier verstanden wird, ist kein absoluter Wert bzw. kein Selbstzweck, sondern dient der Selbst-Entwicklung. So wie Freiheit eine Funktion von Identität ist, so ist unser Selbst eine Funktion von Freiheit bzw. freier Arbeit: je mehr wir das tun, mit dem wir uns identifizieren, desto mehr kommen wir zu uns selbst, desto mehr bilden wir ein Selbst aus. Wer “arbeitet” will etwas aus sich selbst machen; wer “jobbt”, aus dem wird etwas gemacht. Der Schriftsteller Joseph Conrad hat einmal passend über freie Arbeit gesagt: “Ich mag was in der Arbeit steckt, die Möglichkeit zu sich selbst zu finden, zur eigenen Wirklichkeit, wie man sie nur selbst erfahren kann und die kein anderer erlebt.”
Um die „freie Arbeit“ noch besser zu charakterisieren, bietet sich ein Vergleich mit der „notwendigen Arbeit“ an. Die Unterschiede werden der Klarheit wegen idealtypisch dargestellt, wohl wissend, dass in der Praxis Mischformen vorkommen. Bergmann spricht zuweilen von der „Polarität der Arbeit“: der eine Pol stellt Arbeit in ihrer höchsten Form dar, dem Calling; während der andere Pol die Arbeit in ihrer niedersten Form, der Jobarbeit, ist:
Wer zu seiner Arbeit durch Identifikation kommt und nicht dadurch, dass er seine Arbeitskraft auf dem Arbeitsmarkt verkauft, für den wird seine Arbeit mehr als nur ein Job oder eine Beschäftigung sein: sie wird ihm zur Aufgabe, in die er sich als Person einbringen, der er sich als Person widmen kann. In der freien Arbeit geht die Person auf, während sie im Job oft untergeht. Während der Job den Menschen als Arbeitskraft verlangt und diese für den Produktionsprozess und dessen Ziele instrumentalisiert wird, fordert und fördert das Calling die Person als solche. Das heißt: ihre Talente, Fähigkeiten, Anlagen, Eigenschaften werden auf eine selbstbestimmte Aufgabe hin ausgerichtet; die Person als solche wird durch die freie Arbeit entwickelt, gestärkt und hat die Chance über sich hinauszuwachsen.
Calling bedeutet sich selbst auszudrücken, auf sich selbst zu besinnen, sich selbst zu erfahren und zu sich selbst zu kommen. Wer “tut, was er wirklich, wirklich will”, so die typische Wendung Bergmanns, der arbeitet um seiner selbst willen. Der Job hingegen charakterisiert sich dadurch, dass er Arbeit für andere und für anderes ist: so arbeitet man für einen Arbeitgeber, für Geld, für Karriere, für den Markt, für die Rente, für den persönlichen Wohlstand, für Konsum und für Sicherheit. Jobarbeit ist wie jede Form notwendiger Arbeit Ausdruck der Sorge um sein materielles Dasein, der Existenzsicherung oder wie man mal wissenschaftlich sagt: eine Funktion der Reproduktion des Lebens. Wer nur die Jobarbeit kennt, ist ganz versunken in der Notwendigkeit.
Wie jede Form von notwendiger Arbeit so ist auch die Jobarbeit Funktion von etwas und folglich von diesem abhängig. So wie beispielsweise die Hausarbeit Funktion dessen ist, was das Haus verlangt, so ist die Jobarbeit Funktion dessen, was der betriebliche Arbeits- bzw. Produktionsprozess, der Arbeitsmarkt bzw. der Arbeitgeber fordert. Calling ist eine autonome Arbeit, die nur sich selbst verpflichtet ist. Calling heißt, sein eigener Herr zu sein, während man im Job immer einen „Herrn“ über sich hat. Folglich tun wir im Job, was wir tun müssen; während die freie Arbeit darin besteht, dass wir tun, was wir tun wollen.
Der vielleicht deutlichste Unterschied zwischen freier und notwendiger Arbeit zeigt sich darin, wie sie sich jeweils auf den Menschen selbst auswirken. Calling kann die verschiedensten positiven Auswirkungen auf den Menschen haben. In seinen Veröffentlichungen führt Bergmann unter anderem an, dass Calling eine Arbeit ist, die uns lebendiger macht, mehr Kraft und Energie in uns entfesseln kann, als wir zu besitzen glauben, die uns beseelt, die man mit Hingabe und Leidenschaft verfolgen kann und die uns mit Freude und Stolz erfüllt.
Die notwendige Arbeit dagegen wirkt sich meist negativ auf den Menschen aus. Kein Wunder, denn sie nimmt keine oder zu wenig Rücksicht auf die Person. So wie Bergmann das Positive der freien Arbeit in seinen Artikeln und Büchern auflistet, so die negativen Eigenschaften der Jobarbeit. Danach kann sie den Menschen beschämen, erschöpfen, deprimieren, auslaugen, niederdrücken, ermüden, unter- oder überfordern; sie kann Kräfte zehrend und gesundheitsschädigend sein.
Abnehmende Jobarbeit
Für die Zeit des Übergangs vom alten zum neuen Wirtschafts- und Arbeitssystems wird die Jobarbeit noch benötigt, allerdings in abnehmendem Maße. So wie Community Production und Calling eingeführt werden, so kann Jobarbeit entsprechend reduziert werden bis sie so nebensächlich wird, dass sie nicht mehr weiter ins Gewicht fällt oder ganz verschwindet. Die Reduzierung der Jobarbeit wird begünstigt und verstärkt durch die Notwendigkeit einer längst fälligen allgemeinen Arbeitszeitverkürzung. Denn nur diese kann den Mangel an Jobs bzw. die strukturelle Beschäftigungslosigkeit überwinden, die sich daraus ergeben, dass weiter und weiter Jobarbeit rationalisiert wird und immer mehr Güter und Dienstleistungen mit immer weniger menschlicher Arbeitskraft hergestellt werden können. Wenn es an Jobs fehlt bzw. neue nicht ausreichend geschaffen werden können, dann wird Beschäftigungslosigkeit dadurch begegnet, dass die verfügbare Jobarbeit umverteilt wird.
Arbeitszeitverkürzungen sind in der Industriegesellschaft übrigens nichts Neues. Im Gegenteil: bei genauerem Hinsehen zeigt sich hier ein historischer Trend. Die Arbeitszeit betrug in der Gründerzeit zwischen 12 und 16 Stunden bei einer 6-Tage-Woche und wurde dann schrittweise auf den 8-Stunden-Tag bei einer 5 Tage-Woche reduziert. Die Einführung und Erhöhung von Urlaubstagen sowie weiteren Frei- Zeiten wie „Sabbaticals“ haben die Lebensarbeitszeit weiter verringert. Im Grunde setzt die “Neue Arbeit” diesen historischen Trend nur konsequent fort.
Der Wirtschaft kommt eine allgemeine Arbeitszeitverkürzung ebenfalls entgegen: zum einen wäre sie den gesellschaftlichen Druck los, für Vollbeschäftigung zu sorgen, was sowieso außerhalb ihrer Möglichkeiten liegt. Zum anderen passen neue, individuelle gestaltbare Arbeitszeitmodelle in die derzeitigen Bemühungen der Wirtschaft, die bestehenden Beschäftigungsverhältnisse zu flexibilisieren. Nicht zuletzt sprechen die steigenden Arbeitsanforderungen für verkürzte Arbeitszeiten: Hochleistungen, wie sie im Joballtag mehr und mehr gefordert werden, kann man dauerhaft nicht 40 Stunden die Woche erbringen; versucht man es trotzdem, so wie das gegenwärtig der Fall ist, so wirkt sich das kontraproduktiv aus – Arbeitsleistung und Arbeitserfolg werden durch Überforderung konterkariert und dadurch suboptimal.
Zur philosophisch-kulturellen Dimension der Neuen Arbeit
Aus Sicht der Neuen Arbeit dominiert ein Wirtschafts- und Arbeitssystem unser Leben, das nicht die Freiheit des Menschen fördert, sondern ihn funktionalisiert, normiert und anpasst. Es macht die Menschen von sich abhängig und ordnet sie den Zwängen unter, die es zunehmend produziert. Dabei wird der Mensch selbst immer „kleiner“, „ohnmächtiger“, „armseliger“ und „schwächer“. Unser Wirtschafts- und Arbeitssystem entwertet die höheren Lebensziele und macht die bloßen Mittel zum Leben zu absoluten Zwecken. Wir sind nihilistisch, um mit Nietzsche zu reden. Das impliziert unter anderem, dass wir uns fremd geworden sind. Dieses Phänomen der Selbstvergessenheit geht auf das zurück, was Bergmann Selbstunkenntnis nennt (oder eben in der volkstümlichen Form: der Mensch weiß nicht, „was er wirklich, wirklich will“). Er meint die grundlegende Schwierigkeit, vor die das Leben jeden von uns stellt und die damit einhergehende Herausforderung, die jeder Einzelne von uns zu meistern hat: nämlich sich selbst zu erkennen. Das gilt sowohl für die gewichtigen Belange im eigenen Leben als auch für das alltägliche Leben. Ebenso gilt es für die Frage, welche Arbeit zu uns passt und die uns selbst am besten dient.
Wo die Selbstunkenntnis das Leben der Menschen beherrscht, wird das Leben im eigentlichen Sinne nicht gelebt. Nichts ist dann leichter, als sein Leben zu vergeuden, die Orientierung zu verlieren, vom Weg abzukommen, sich zu zerstreuen, Nebensächliches zur Hauptsache zu machen und dabei sich immer mehr zu verlieren. Bei vielen Menschen scheint es so zu sein, als ob sie ihr Leben auf stand-by gestellt hätten: sie bringen gerade genug Energie auf, um zu funktionieren, aber die eigentliche Lebensenergie entflammt nicht. Man lebt von Tag zu Tag, ohne genau zu wissen wofür und wozu; man ist beschäftigt; man sorgt dafür, dass man immer gut beschäftigt ist; man macht und tut, läuft und läuft – und bewegt sich dennoch nicht. Wann immer man zurückschaut auf sein Leben und ehrlich genug über sich selbst urteilt, wird man feststellen, dass da wenig oder nichts von Bedeutung oder Belang war. Das Lebensmotto vieler Menschen könnte lauten: Viel Lärm um Nichts.
Die “Neue Arbeit” will diesen Zustand umkehren: das ist ihr entscheidendes Anliegen. Bergmann schreibt in seinem Buch: “Es ist nicht möglich, die Neue Arbeit zu verstehen, ehe man die Allgegenwärtigkeit des nicht gelebten Lebens verstanden und akzeptiert hat.” (Frithjof Bergmann, Neue Arbeit – Neue Kultur, Arbor Verlag, Freiburg, 2004, Seite 284). Die Neue Arbeit möchte den Menschen zu einem wirklich gelebten Leben, zu einem freien Leben verhelfen – und die Arbeit ist das Vehikel dazu (Vgl. ebd. Seite 376 f).
Wer dem Aufruf der “Neuen Arbeit” folgt (tue, was Du wirklich, wirklich willst), der wird allmählich das Begehren im eigentlichen Sinne lernen; der wird seine Selbstunkenntnis zumindest in Bezug auf die Arbeit relativieren und etwas Licht ins Dunkel seiner Existenz bringen; der wird sich hervorbringen, was er der Möglichkeit nach ist und schließlich erfahren, was ein erfüllendes Leben sein kann. Das ist der tiefere Grund bzw. der hohe Anspruch der Neuen Arbeit: sie will ein neues Wirtschafts- und Arbeitssystem initiieren, das das alte überwindet samt den Krisen und Verwerfungen, die es produziert und sie will zugleich Keimzelle für eine neue Kultur sein, in der der Mensch zu sich selbst kommen kann.